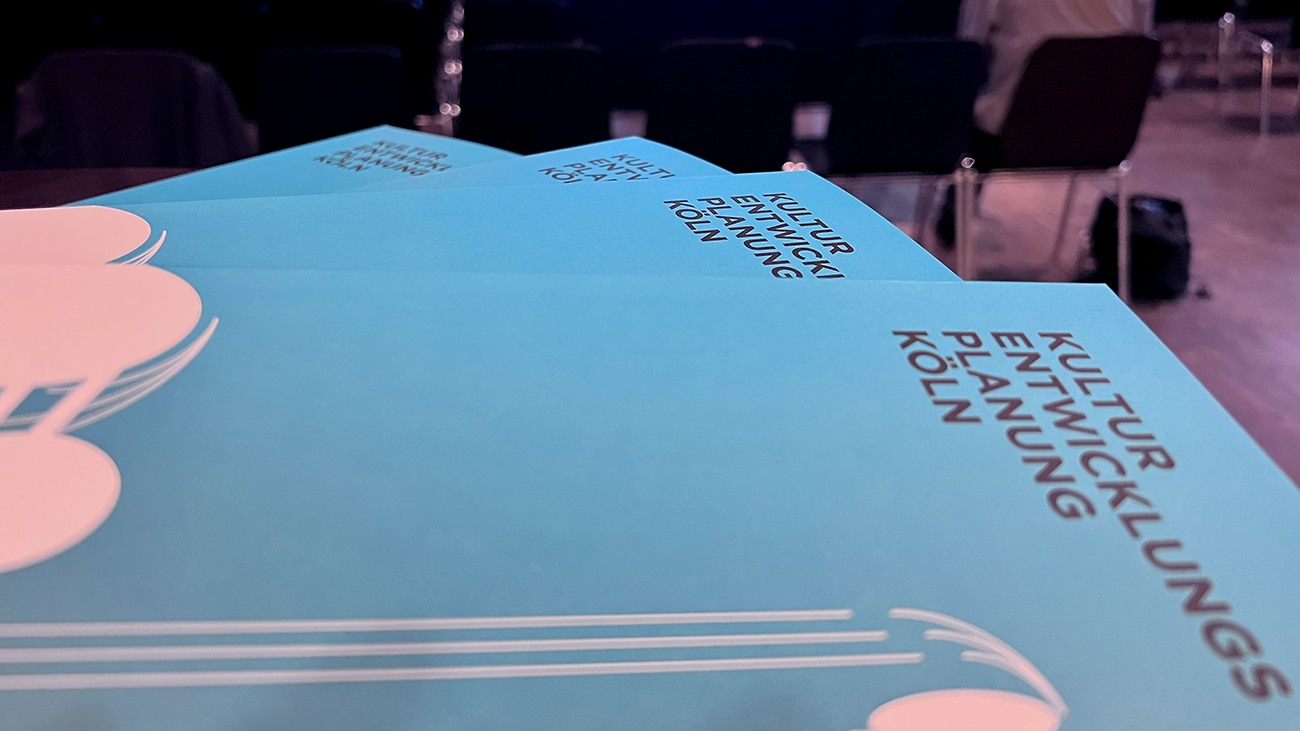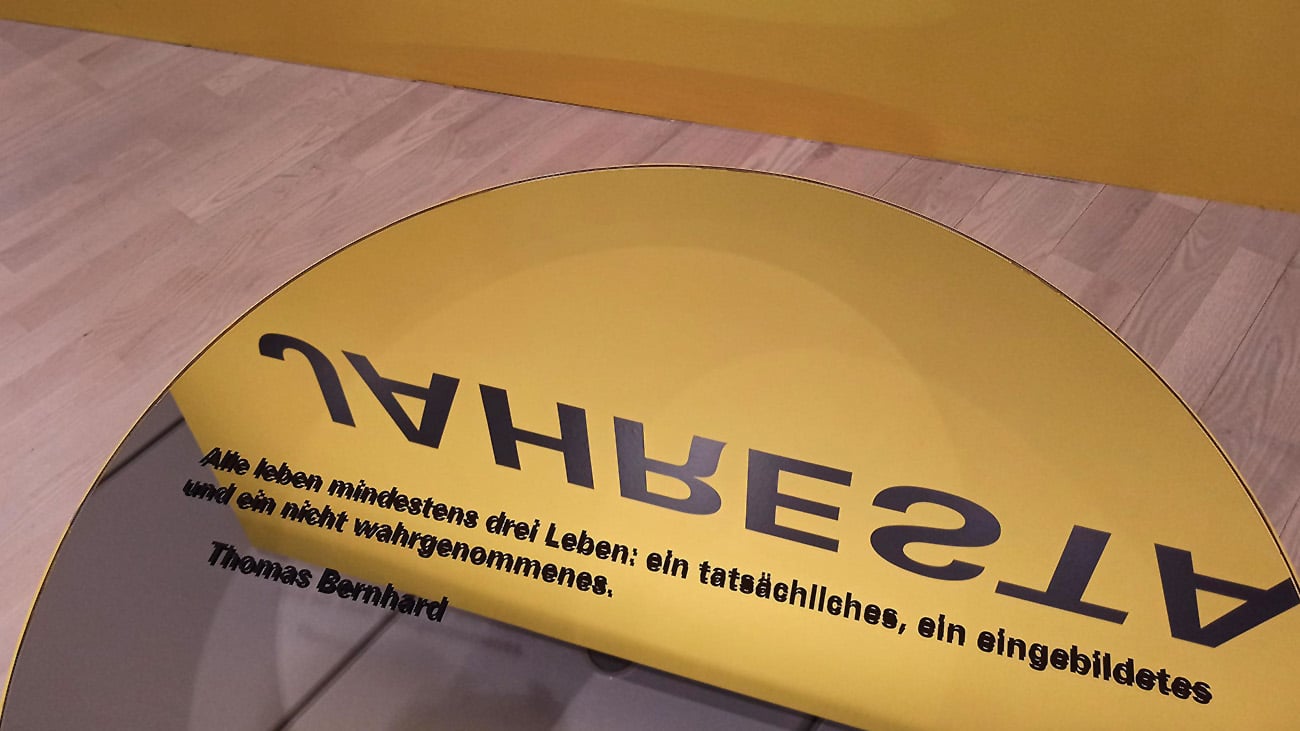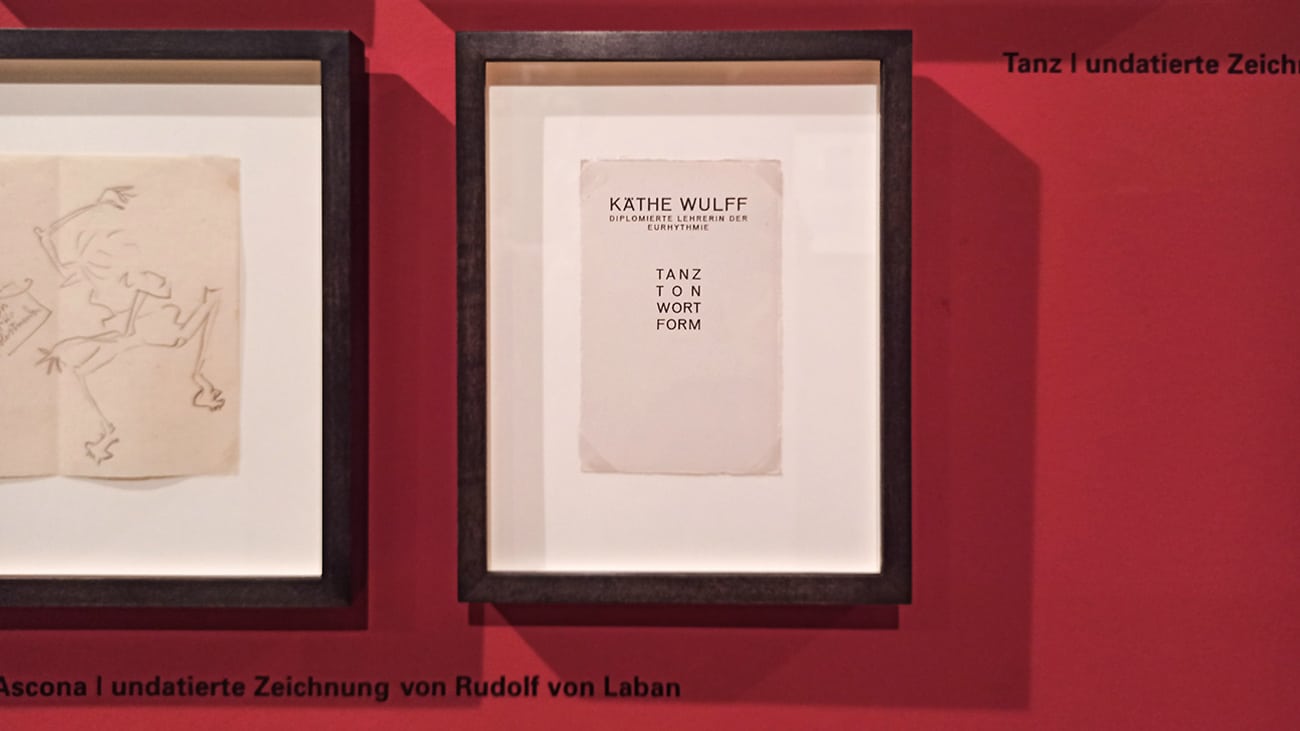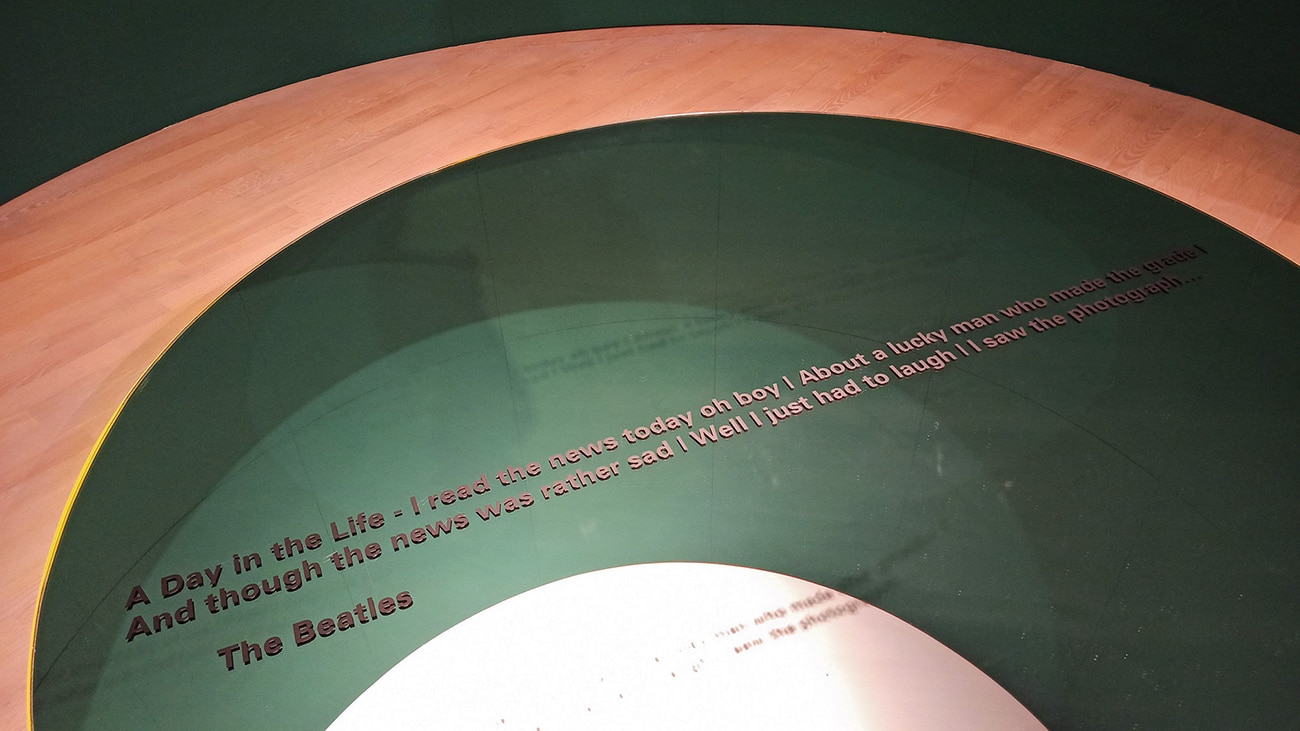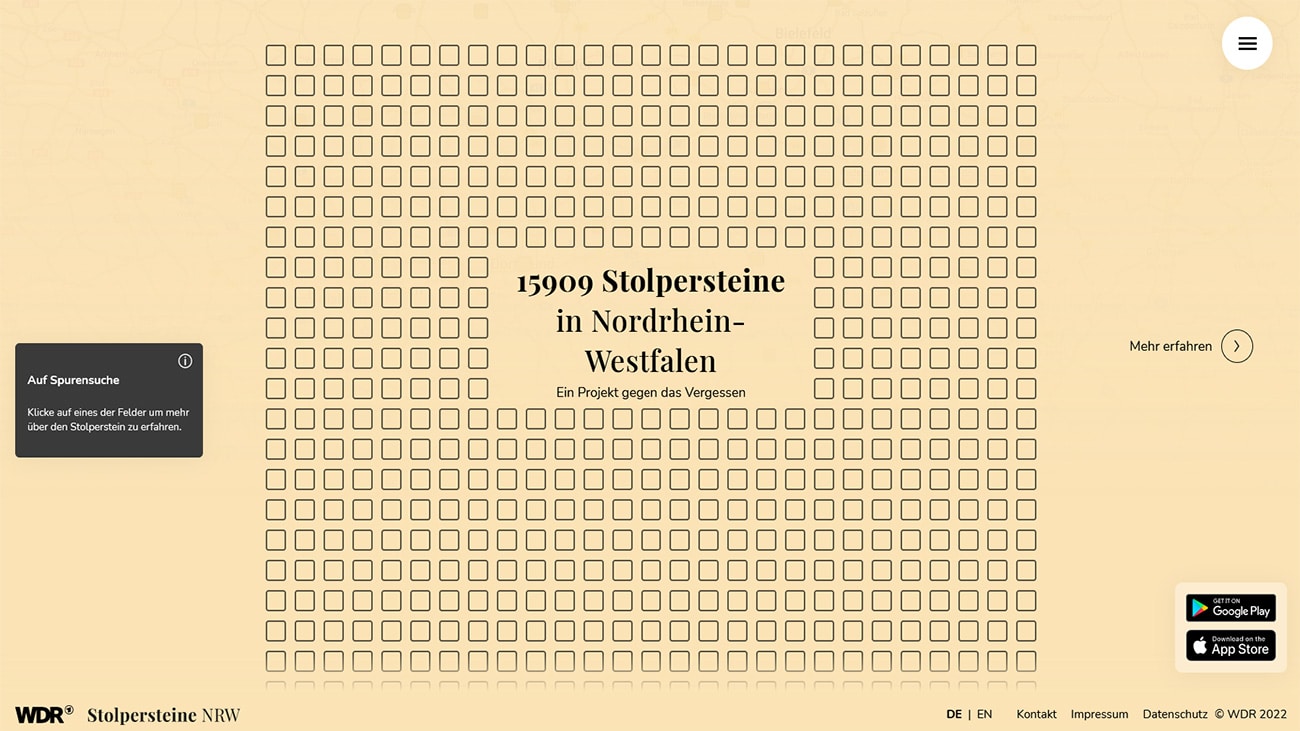Kölner Barcamp „Ökologische Nachhaltigkeit in der Kultur“
Am 1. September fand das erste Barcamp „Ökologische Nachhaltigkeit in der Kultur“ statt. Geladen hatte die Kulturentwicklungsplanung (KEP) der Stadt Köln. Deren Ziel es ist, Perspektiven und Ziele zu erarbeiten, mit welchen die Kölner Kunst und Kulturszene gestärkt und gefördert werden kann. Wir sind der Einladung hierzu gerne gefolgt.
Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Sie prägt zunehmend jeden Bereich unseres Lebens, und die Kultur bildet da keine Ausnahme. Umso erfreulicher, dass die Stadt Köln das Thema im Rahmen der 2019 beschlossenen Kulturentwicklungsplanung kontinuierlich unterstützen will. Unter anderem in Form eines Barcamps. Als Veranstaltungsort wurde das Bürger- und Kulturzentrum Stollwerck in der Kölner Südstadt gewählt.
Zum Auftakt erklärte Stefan Charles, Beigeordneter für das Dezernat Kunst und Kultur, dass ein Aktionsnetzwerk aus Berlin die Stadt Köln im Projekt „Köln hoch 3 – Kultur weiterbilden, bilanzieren, transformieren“ bereits unterstützt hat und auch weiterhin begleiten wird. Das Barcamp markierte tatsächlich den offiziellen Start von „Köln hoch 3“. Für dieses Projekt hat das Dezernat eigens eine Stelle eingerichtet. Ziel ist es, Ausstellungen und Aufführungen in unserer Stadt klimafreundlicher zu gestalten. Beteiligt sind insgesamt 18 Kölner Kulturstätten.
Um einen tieferen Einblick in das Thema zu gewähren, folgte im Anschluss ein kurzer, aber aufschlussreicher Impulsvortrag von Dr. Carolin Baedecker vom Wuppertal Institut für anwendungsorientierte Nachhaltigkeitsforschung, einer wissenschaftlichen Einrichtung des Landes NRW. Die Mission des Instituts liegt darin, durch Realexperimente die Forschung an der Schnittstelle von Praxis und Theorie zu fördern.
Ein besonders prägnanter Aspekt ihres Vortrags war der Hinweis auf die Bedeutung, den Klimawandel greifbarer und intuitiver zu machen. Als Beispiel führte sie die „Warming Stripes“ von Ed Hawkins aus dem Jahr 2016 an. Jeder farbige Streifen repräsentiert dabei die durchschnittliche Jahrestemperatur im Vergleich zum Durchschnitt des 20. Jahrhunderts: Blau symbolisiert kältere, Rot wärmere Jahre. Hawkins Designkonzept stieß auf große Resonanz und führte zu einem regelrechten Trend. Seither sind zahlreiche Produkte im „Warming Stripes“-Design erhältlich, darunter Bettwäsche, Handtücher, Flipflops und vieles mehr.
Im Weiteren hob Dr. Baedecker die Bedeutung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele hervor. Besonders im Blickpunkt der Kultur stehen die Ziele Nummer 12 („Nachhaltiger Konsum & Produktion“) und 17 („Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“). In Hamburg beispielsweise initiierten Kulturbetriebe das Projekt „Elf zu Null – Hamburger Museen handeln“. Mit Hilfe von Experten legten die beteiligten Museen ihre CO2-Bilanzen fest, um eine nachhaltige Veränderung herbeizuführen. Ein weiteres Projekt, das Dr. Baedecker in diesem Zusammenhanf hervorhob, realisierte die Oper Wuppertal, die in Zusammenarbeit mit dem Wuppertal Institut ein Selbstanalyse-Tool für die Nachhaltigkeitsbewertung kreierte.
Das Thema Nachhaltigkeit kunstvoll inszenieren
Auch die Kunst selbst kann das Thema Nachhaltigkeit in ihren Fokus rücken, wie Carolin Baedecker weiter ausführte. Der erste, der dies eindrücklich tat, war Joseph Beuys, als er 1982 im Rahmen der documenta 7 den Gedanken „Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“ prägte, um die Bedeutung von Natur und Ökologie im urbanen Raum zu betonen. Beispiele aus der Gegenwart sind das Schauspielhaus Bonn, welches das Buch der Transformationsforscherin Maja Goepel auf die Bühne gebracht hat, oder auch die Ausstellungen „Ökorausch“ und „Between the Trees“ des Kölner Museums für Angewandte Kunst (MAKK). Bei all diesen Realexperimenten gehe es darum, den Raum für den Menschen mit der Natur neu erfahrbar zu machen und so den Dialog zwischen Mensch und Natur durch Kunst und Kultur neu zu definieren. Viele weitere Beispiele zu „Kunst, Kultur und Nachhaltigkeit“ finden sich auf der gleichnamigen Website.
Dr. Baedecker machte aber auch klar: Um eine nachhaltige Neuausrichtung im Kunst- und Kultursektor zu bewirken, sind sowohl Raum als auch finanzielle Unterstützung unabdingbar. In Sachen „Raum“ hat das Wuppertal Institut in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Design und Kunst der Bergischen Universität Wuppertal und 14 weiteren Partnern, darunter creative.nrw, die Kooperationsplattform Transform.NRW ins Leben gerufen. Dort sollen die Kräfte von Kunst, Kultur und Design gebündelt werden, um nachhaltige Entwicklungen voranzutreiben.
Nachhaltigkeit braucht positive Zukunftsbilder
Der zweite Impulsvortrag nahm dann nochmal eine andere Perspektive ein. In ihrer Keynote „Die Kunst der Transformation: Wie sich Kunst, Wissenschaft & Innovation verbinden lassen, um die größten Herausforderungen der Welt zu bewältigen“ stellte Nicole Loeser heraus: Bei den Budgetierungen für nachhaltige Konzepte gibt es unterschiedliche Bewertungen. Die Kultur komme meist zuletzt, die Wirtschaft zuerst. Dabei sei die Kunst wesentlich, wenn es um das Darstellen und kritische Hinterfragen gehe. Aufgabe der Wissenschaft sei es, dazu zu forschen. Bleibt die herausfordernde Frage: Wie bekommt man Kultur, Wissenschaft und dann noch die daraus resultierende Innovation zusammen? Nicole Loeser appellierte in ihrem Vortrag dafür, systemisch zu denken und neue Ideen zur Schaffung von Kooperation zu entwickeln. Aus dieser Motivation heraus hat sie das Institute for Art and Innovation (IFAI) in Berlin mitgegründet. Dort kreieren multistake Kooperationen auf EU-Ebene große Visionen. Im Rahmen des IFAI-Projekts „Art for Futures Labs“ etwa würden positive Zukunftsbilder geschaffen. In den Workshops zeige sich deutlich, so Loeser, dass den Teilnehmenden dies kaum noch gelinge – auch, weil ihnen das Wissen über innovative Konzepte schlicht fehle. Genau da setzt ein weiteres Projekt von IFAI namens „Green Education in Media“ an. Denn, so eine weitere Erfahrung von Nicole Loeser: Bei den Lehrenden an unseren Hochschulen fehle es häufig an Wissen zu neuer Technik und neuen Formaten.
Mit ihrem persönlichen Statement „Kunst ist die Wissenschaft der Freiheit“ und dem Hinweis auf den Satz von Gerhard Richter „Kunst ist die höchste Form der Hoffnung“ (Gerhard Richter) rundete Nicole Loeser ihren eindrucksvollen Vortrag ab.
Nachhaltige Konzepte und Ideen in die Kommunikation miteinbeziehen
In nahezu allen Sessions, an denen ich teilnahm, war das Thema „Kommunikation“ präsent. Einige Mitarbeitende der Kölner Kulturbetriebe überlegten, wie die Öffentlichkeit ihre Bestrebungen hin zu mehr Nachhaltigkeit wohl wahrnehmen und ob sie ausreichend informiert würden. Andere zweifelten, ob die Publika daran denn überhaupt interessiert seien. Viele waren aber überzeugt, dass Social Media ihnen eine unschätzbare Möglichkeit bietet, Gäste und Besuchende auf ihrem Weg zu einer nachhaltigen Kunst- und Kulturlandschaft in Köln mitzunehmen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Dank Plattformen wie Instagram können Kulturstätten sowohl neue als auch jüngere Zielgruppen ansprechen und gleichzeitig ältere Generationen für den gesellschaftlichen Impact des Themas sensibilisieren.
Besucher*innen von Kulturstätten reflektieren dabei wahrscheinlich selten, welche Ressourcen – Zeit, Energie und Geld – benötigt werden, um den Kulturbetrieb sukzessive nachhaltiger zu gestalten. Dies wurde mir selbst in der Session „Nachhaltigkeitskultur Köln in der Clubszene“ besonders bewusst. So hat beispielsweise die Initiative „Zukunft feiern“ mit ihrem „Clubtopia: Feiern, als gäbe es ein Morgen“-Ansatz ein ausführliches, kostenfreies Nachhaltigkeitskonzept für die Berliner Clubszene erarbeitet. Der daraus resultierende Code of Conduct wird von immer mehr Clubbetreiber*innen angenommen. Meiner Ansicht nach sollten die beteiligten Clubs dieses Thema fest in ihre Kommunikationsstrategie integrieren. In der Session wurde dieser von mir geäußerte Vorschlag dahingehend kritisiert, dass dies zusätzlichen Aufwand und somit Kosten verursache. Mein Gegenargument: Wenn es bereits eine gemeinsame Initiative gibt, könnte diese auch eine Art gemeinsame Kommunikationsstrategie für die Clubbetreiber*innen entwickeln – etwa durch visuelle Vorlagen, die dann von allen genutzt werden können. Auch das wäre nachhaltig.
Gemeinsam, kontinuierlich und strukturiert
In der Kunst- und Kulturszene ist Nachhaltigkeit mittlerweile unausweichlich. Doch wie diese Herausforderung konkret angegangen werden soll, scheint vielen noch unklar zu sein. Das überrascht mich nicht, denn ein nachhaltiges Vorgehen ist ein komplexes, anspruchsvolles und stetiges Unterfangen. Der Schlüssel liegt aus meiner Sicht im gemeinsamen Handeln und im kontinuierlichen Austausch.
Das Barcamp hat hierfür einen Ausgangspunkt geschaffen. Es hat die Bedeutung des stetigen Dialogs zwischen den Kölner Kulturbetrieben und den darin engagierten Personen hervorgehoben. Eine offene Frage für mich ist jedoch, ob es nicht auch klare Richtlinien seitens der Stadt geben sollte, die den Akteuren im Kulturbereich einen Rahmen für ihre Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit bieten. Die Gründung der Koordinationsstelle „Nachhaltigkeit in der Kultur“ könnte bereits ein Schritt in diese Richtung sein.